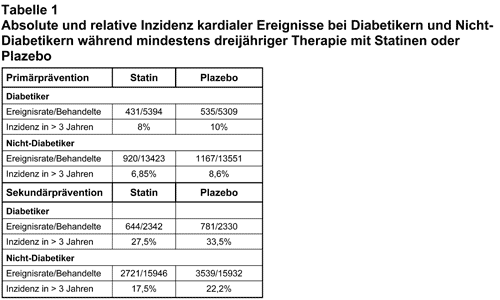Wir haben mehrfach über die Wirksamkeit von Statinen zur Verhinderung kardiovaskulärer Ereignisse bei Typ-2-Diabetikern berichtet. In der plazebokontrollierten Heart Protection Study (HPS; 1) ergab eine Subgruppen-Analyse von fast 6000 Diabetikern – die Hälfte mit bereits manifester Arteriosklerose bei Studienbeginn – eine gleich gute kardioprotektive Wirkung von 40 mg/d Simvastatin über fünf Jahre wie bei Nicht-Diabetikern, und zwar unabhängig vom Ausgangswert der Lipide. In der ASCOT-LLA-Studie an hypertonen Diabetikern und Nicht-Diabetikern mit zusätzlichen kardiovaskulären Risikofaktoren und normalem Serum-Cholesterin reduzierten 10 mg/d Atorvastatin zwar bei Nicht-Diabetikern, nicht aber bei Diabetikern in fünf Jahren das kardiovaskuläre Ereignis-Risiko signifikant (2). Hingegen war die gleiche Dosis Atorvastatin in der CARDS-Studie bei Typ-2-Diabetikern mit einigen zusätzlichen Risikofaktoren und normalen Blutfetten in der Primärprävention kardiovaskulärer Erreignisse über knapp vier Jahre signifikant protektiv (3).
Im BMJ erschien jetzt eine nicht von der Industrie gesponserte Metaanalyse von J. Costa et al. aus Lissabon (4), in der zwölf plazebokontrollierte, randomisierte Studien zur Lipidsenkung zwecks Primär- und Sekundärprävention kardialer Ereignisse (Tod durch KHK, nicht-tödlicher Myokardinfarkt, koronare Interventionen) ausgewertet wurden. Alle Studien ließen den Vergleich der Wirksamkeit dieser Therapie bei Diabetikern und Nicht-Diabetikern zu. Die Mindest-Interventions-Dauer war drei Jahre. Alle größeren Studien wurden mit Statinen durchgeführt. Eine für die Primärprävention berücksichtigte Studie mit Gemfibrozil ist sehr klein und bedeutungslos, während eine andere Gemfibrozil-Studie für die Sekundärprävention einen signifikant protektiven Effekt ergab.
Aus den mitgeteilten Zahlen lassen sich die in Tab. 1 dargestellten Ereignisraten während mindestens drei Jahren Intervention versus Plazebo errechnen. Sowohl bei Diabetikern wie bei Nicht-Diabetikern wird in der Primär- wie in der Sekundärprävention die kardiale Ereignisrate durch Statine etwa um relative 20% im Vergleich mit Plazebo gesenkt (absolute Risikoreduktion s. Tab. 1). Da jedoch die Ereignisrate bei Diabetikern höher ist als bei Nicht-Diabetikern und in den Studien zur Sekundärprävention wiederum in beiden Gruppen deutlich höher ist als in der Primärprävention, kommen die Autoren zu dem Schluss, dass Diabetiker mindestens so gut von einer Statin-Therapie profitieren wie Nicht-Diabetiker mit vergleichbarem Risiko. Die Indikation ist also immer vom Gesamtrisiko abhängig. Entsprechende Tabellen sind hilfreich.
Die Erörterungen der Ergebnisse durch die Autoren werden durch einen Kommentar von J.P.D. Reckless aus England (5) ergänzt. Er empfiehlt, bei allen Typ-2-Diabetikern die Behandlung mit Statinen zu erwägen und sie bei allen mit zusätzlichen kardiovaskulären Risikofaktoren, einschließlich einer LDL-Cholesterin-Konzentration im Serum von > 2 mmol/l (> 77 mg/dl), auch zu beginnen. Er empfiehlt Statine auch für Typ-1-Diabetiker über 40 Jahre und für jüngere mit Risikofaktoren, wie mikrovaskulären Veränderungen, Hypertonie, schlechter BZ-Einstellung und riskanter Familienanamnese hinsichtlich kardiovaskulärer Ereignisse. Letztere Empfehlungen ließen sich aber weniger gut mit Studienergebnissen untermauern als die für Typ-2-Diabetiker.
Fazit: Typ-2-Diabetiker profitieren von einer Statin-Therapie mindestens so deutlich wie Nicht-Diabetiker hinsichtlich der Verhinderung kardialer Ereignisse. Typ-2-Diabetiker mit zusätzlichen kardiovaskulären Risikofaktoren, auf jeden Fall aber solche mit bereits eingetretenen kardiovaskulären Ereignissen (Sekundärprävention), sollten mit Statinen in einer dem Gesamtrisiko angemessenen Dosierung behandelt werden.
Literatur
- MRC/BHF Heart Protection Study (HPS): Lancet 2002, 260, 7; s.a. AMB 2003, 37, 54.
- Sever, P.S., et al. (ASCOT-LLA = Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Lipid Lowering Arm): Lancet 2003, 361, 1149; s.a. AMB 2003, 37, 43.
- Colhoun, H.M., et al. (CARDS = Collaborative AtoRvastatin Diabetes Study): Lancet 2004, 364, 685; s.a. AMB 2004, 38, 75.
- Costa, J., et al.: BMJ 2006, 332, 1115.
- Reckless, J.P.D.: BMJ 2006, 332, 1103.