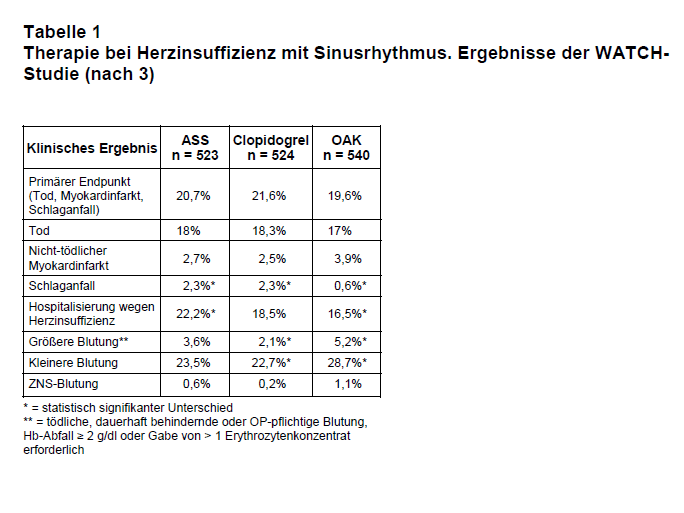Patienten mit Herzinsuffizienz und Vorhofflimmern haben ein erhöhtes Risiko für kardioembolische und thrombotische Ereignisse. Orale Antikoagulanzien (OAK) reduzieren dieses Risiko signifikant (1). Sie sind daher bei permanentem oder intermittierendem Vorhofflimmern mit hohem Evidenzgrad indiziert (2). Aber auch bei Herzinsuffizienz mit Sinusrhythmus besteht wegen des verminderten Herzzeitvolumens eine Hyperkoagulabilität. Bislang ist nicht geklärt, ob auch solche Patienten von OAK bzw. ASS profitieren oder, wenn keine KHK als Grunderkrankung vorliegt, überhaupt antithrombotisch behandelt werden sollten.
Eine weitere, häufig diskutierte Frage in der Therapie der Herzinsuffizienz ist, ob ASS wegen seiner Prostaglandin-hemmenden Effekte nicht die Wirkung von ACE-Hemmern abschwächt. In kleineren Studien wurde gezeigt, dass Patienten unter ASS häufiger wegen kardialer Dekompensation hospitalisiert werden müssen. Daher stellt sich die Frage, ob nicht ein anderer Hemmer der Thrombozytenfunktion für herzinsuffiziente Patienten besser geeignet ist.
Beiden Problemen sollte die WATCH-Studie (3) nachgehen. Hierzu wurden in einer prospektiven, randomisierten kontrollierten Studie zwischen 1999-2002 an 142 Zentren in den USA, Kanada und UK insgesamt 1 587 Patienten mit symptomatischer Herzinsuffizienz eingeschlossen. Sie mussten eine linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LVEF) ≤ 35% haben und im Sinusrhythmus sein. Das mittlere Alter betrug 63 Jahre, 85% waren Männer, 73% hatten ursächlich eine KHK. Die Randomisierung erfolgte in drei Arme: Open label Warfarin (Ziel-INR: 2,5-3) bzw. doppeltblind 162 mg ASS oder 75 mg Clopidogrel täglich.
Primärer Endpunkt in der WATCH-Studie war die Kombination von Tod, nicht-tödlichem Myokardinfarkt und Schlaganfall. Sekundäre Endpunkte waren die Häufigkeit jedes einzelnen der genannten Ereignisse allein sowie Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz. Sicherheitsendpunkte waren größere und kleinere Blutungen. Ursprünglich war geplant, in jede Gruppe 1 500 Patienten einzuschließen. Da der Einschluss der Patienten aber sehr langsam erfolgte, wurde die Rekrutierungsphase frühzeitig abgebrochen. So wurden anstelle der geplanten 4 500 Patienten letztlich nur 1 587 randomisiert. Die berechneten statistischen Vorgaben mussten daher nachträglich geändert werden.
Ergebnisse: Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 1,9 Jahre (3 073 Patientenjahre). Insgesamt konnten 89 Patienten nicht weiterverfolgt werden, und je etwa 100 Patienten in jeder Gruppe setzten die Studienmedikation ab. Während der Nachbeobachtungsphase trat bei 10% der Patienten Vorhofflimmern auf. Ein „Cross-over” zu OAK war im Studiendesign nicht vorgesehen. Die „Adherence” zur Medikation wurde an Hand der zurückgebrachten Tablettenpackungen mit 80% ermittelt. 70,4% der gemessenen INR-Werte waren im Zielbereich.
Die klinischen Ergebnisse sind in Tab. 1 wiedergegeben. Für den primären Endpunkt fanden sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Gruppen. Bei den sekundären Endpunkten fanden sich drei geringe, aber signifikante Unterschiede:
1. Unter OAK kam es zu weniger Schlaganfällen als unter ASS bzw. Clopidogrel. Dies ist wahrscheinlich auf die hohe Inzidenz von Vorhofflimmern bei Herzinsuffizienz zurückzuführen (bei 10% der Patienten wurde dies während der Studie dokumentiert; viele Episoden werden aber gar nicht wahrgenommen).
2. Unter OAK mussten weniger Patienten wegen Herzinsuffizienz stationär aufgenommen werden als unter ASS. Die befürchtete Abschwächung der ACE-Hemmer-Wirkung durch ASS (162 mg/d) konnte also bestätigt werden. Allerdings gab es keinen signifikanten Unterschied zwischen ASS und Clopidogrel.
3. Unter OAK traten vermehrt größere und kleinere Blutungen auf als unter Clopidogrel.
Die Ergebnisse der WATCH-Studie sind unseres Erachtens zur Entscheidung, ob und wie ein herzinsuffizienter Patient mit Sinusrhythmus antithrombotisch behandelt werden muss, nur in wenigen Punkten hilfreich. Liegt eine KHK vor, muss ein Patient zur Sekundärprophylaxe ohnehin einen Thrombozytenfunktionshemmer erhalten. OAK sind in dieser Situation keine Alternative. Clopidogrel scheint aber nicht sicherer zu sein als ASS hinsichtlich einer ungünstigen Interaktion mit ACE-Hemmern. Ob eine geringere Dosis ASS (wie in Europa üblich) sicherer ist, wurde nicht untersucht. Auch ist WATCH wegen der kleineren als geplanten Gruppen, für die Beantwortung der Frage ob Clopidogrel oder ASS günstiger ist, statistisch nicht geeignet. Dies müsste in einer neuen, eigenen Studie beantwortet werden.
Liegt keine KHK vor (also z.B. eine Kardiomyopathie), dann wissen wir nun, dass OAK einem Thrombozytenfunktionshemmer nicht überlegen sind. Wir wissen jedoch nicht, ob man überhaupt antithrombotisch behandeln sollte, da ein Plazebo-Arm fehlt.
Die Entscheidung des Studienprotokolls, Patienten, die Vorhofflimmern entwickeln, nicht zu antikoagulieren, ist ethisch fragwürdig. Auch ist zu kritisieren, dass die Studienergebnisse, die nach den angegebenen Rekrutierungs- und Nachbeobachtungszeiten spätestens bereits 2005 vorgelegen haben müssen, erst jetzt publiziert werden.
Fazit: Bei schwerer linksventrikulärer Herzinsuffizienz mit Sinusrhythmus können orale Antikoagulanzien nicht generell empfohlen werden. Die Indikation bleibt eine Einzelfallentscheidung unter Berücksichtigung anderer thromboembolischer Risikofaktoren (z.B. bei vergrößertem linken Vorhof oder Mitralinsuffizienz). Die Abschwächung der ACE-Hemmer-Wirkung durch ASS (162 mg/d) führt, verglichen mit oralen Antikoagulanzien, zu häufigeren Dekompensationen und Hospitalisierungen. Clopidogrel, das nicht in den Prostaglandin-Stoffwechsel eingreift, scheint nach den vorliegenden Daten nicht sicherer zu sein. Allerdings ist mit dem Design der WATCH-Studie keine therapeutische Gleichwertigkeit nachzuweisen.
Literatur
- AMB 2006, 40, 60. Link zur Quelle
- Dickstein, K., et al. (ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008): Eur. Heart J 2008, 29, 2388. Link zur Quelle
- Massie, B.M., et al. (WATCH = Warfarin and Antiplatelet Therapy in Chronic Heart failure): Circulation 2009, 119, 1616. Link zur Quelle