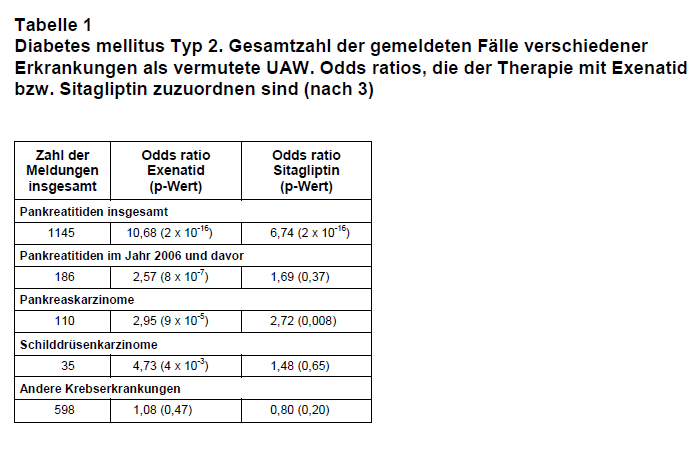Zusammenfassung: Im Februar 2011 erschien als Online-Veröffentlichung der Zeitschrift Gastroenterology ein Artikel, in dem über eine große Zahl von Meldungen an das Adverse Event Reporting System (AERS) der US-amerikanischen Food and Drug Administration zu den unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) Pankreatitis und Pankreaskarzinom bei Diabetikern berichtet wurde, die die Inkretinmimetika Exenatid (Byetta®) und Sitagliptin (Januvia®, Xelevia®) angewandt hatten (1). Die Meldungen von Pankreatitis unter Exenatid-Therapie waren ca. zehnmal häufiger als bei Therapie mit anderen Antidiabetika. Das AERS nimmt nicht nur Meldungen von Ärzten, sondern auch von Patienten entgegen. Über die Online-Veröffentlichung wurde in vielen Tageszeitungen berichtet. Die vorgesehene Druckfassung der Arbeit blieb jedoch zunächst aus, nachdem die Herstellerfirmen Novo Nordisk und Merck (USA) in umfangreichen Schreiben darauf hingewiesen hatten, dass Meldesysteme wie das AERS nicht geeignet seien, die Häufigkeit von UAW bei bestimmten Medikamenten zu erfassen. Im Jahr 2007 waren bereits Einzelmeldungen über Pankreatitiden bei Anwendern von Exenatid durch die Laienpresse gegangen. Auch sprachen die Zulassungsstudien und spätere retrospektive Kohortenstudien gegen vermehrtes Auftreten von Pankreatitiden bei Anwendern von Inkretinmimetika. Über den Schlagabtausch zwischen der Zeitschrift, den Herstellern und den Autoren berichtete kürzlich das BMJ (2). Im Juli 2011 ist nun die Druckfassung der Arbeit von Elashoff et al. in leicht veränderter Form erschienen (3). Wir haben unsere bereits für die April-Ausgabe des AMB vorgesehene Besprechung überarbeitet. Der Widerspruch zwischen den Meldungen im AERS und den Ergebnissen der Zulassungsstudien bzw. der nach der Zulassung durchgeführten Kohorten-Studien zu den UAW von Inkretinmimetika muss methodische Gründe haben. Wir empfehlen weiterhin, Inkretinmimetika nicht als Antidiabetika erster Wahl einzusetzen.
Wir haben mehrfach über neue Antidiabetika berichtet, die als Inkretinmimetika bezeichnet werden (4-8). Exenatid (Byetta®) und Liraglutid (Victoza®) sind Analoga des intestinalen Hormons Glucagon-like peptide-1 (GLP1), das nach Nahrungsaufnahme in den Kreislauf gelangt und hämatogen die Insulinsekretion stimuliert (zusätzlich zum stimulierenden Effekt des Blutzuckers). Beide Präparate werden s.c. injiziert. Sitagliptin (Januvia®; Xelevia®), Saxagliptin (Onglyza®) und Vildagliptin (Galvus®, Jalra®) sind oral einzunehmende Dipeptidyl-Peptidase-Typ-IV(DPP-IV)-Hemmer, die den Abbau des körpereigenen GLP1 hemmen und damit die postprandiale Stimulation der Insulinsekretion durch GLP1 verstärken.
Schon bald nach Zulassung von Exenatid wurde über Einzelfälle von Pankreatitis als mögliche UAW berichtet (5). In der Zeitschrift Gastroenterology publizierten M. Elashoff et al. aus Los Angeles im Februar 2011 (ahead of print) eine Studie über die Häufigkeit von Meldungen an das Adverse Event Reporting System (AERS) der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) über Pankreatitis, Pankreaskarzinom, Schilddrüsenkarzinom und andere Karzinome bei Typ-2-Diabetikern, die bestimmte Antidiabetika anwandten (1). Der Verdacht bezog sich auf Exenatid und Sitagliptin. Als Vergleich (Kontroll-Gruppe) dienten Typ-2-Diabetiker, die die oralen Antidiabetika (OAD) Rosiglitazon (Avandia®, inzwischen vom Markt genommen, vgl. 9), Nateglinid (Starlix®), Repaglinid (Novonorm®) oder Glipizid (in Deutschland nicht auf dem Markt) eingenommen hatten. Als Kontroll-Meldungen (hinsichtlich eines möglichen Zusammenhangs mit der Anwendung der o.g. Antidiabetika) wurden die Symptomgruppen Rückenschmerz, Harnwegsinfektion, Thoraxschmerz, Husten und Synkope ausgewählt. Grundsätzlich sind Meldungen an das AERS von behandelnden Ärzten, aber auch von Patienten möglich, und bei vielen Meldungen konnte nicht überprüft werden, ob die Diagnosen Pankreatitis, Pankreaskarzinom oder andere Karzinome auch zutrafen. Meldungen, die von Ärzten oder Patienten an die pharmazeutischen Hersteller gerichtet wurden, mussten von diesen per Gesetz an das AERS weitergereicht werden. Im Folgenden beziehen wir uns auf die im Juli 2011 erschienene Druckfassung des Artikels von Elashoff et al. (3).
Als Beispiel für die Ermittlung der Odds Ratios = OR (relatives Risiko für ein Ereignis, wobei eine OR von 1,0 kein erhöhtes Risiko, eine OR von 2,0 ein doppeltes Risiko bedeutet usw.) seien Meldungen zu Pankreatitis bei Patienten angeführt, die Exenatid spritzten. Diese Patienten oder deren Ärzte meldeten 971mal Pankreatitis und 1433mal Kontroll-Ereignisse (s.o., Rückenschmerz etc.). Patienten der Kontroll-Gruppe, die Rosiglitazon oder andere OAD einnahmen, meldeten 43mal Pankreatitis und 678mal Kontroll-Ereignisse. Aus dem Quotienten Pankreatitis:Kontroll-Ereignisse ergibt sich für Exenatid eine OR von 10,68 (s. Tab. 1). Diese hoch-signifikante OR würde für Patienten unter Exenatid ein ca. 10fach höheres Pankreatitis-Risiko als bei Kontroll-Patienten anzeigen, wären diese Ergebnisse z.B. in einer prospektiven doppeltblinden Vergleichsstudie erhoben worden. Da in den USA wie auch in Europa in der Laienpresse im Jahr 2007 über den Verdacht einer Assoziation von Exenatid mit Pankreatitis berichtet wurde, könnte das zu erhöhter Aufmerksamkeit und zu einem sog. „Reporting bias” geführt haben. Allerdings wurde die Zahl der Patienten, die in den USA Exenatid bzw. Kontroll-Medikamente anwandten, nicht ermittelt. Somit ist auch das absolute Risiko unbekannt.
Elashoff et al. bewerten ihre Befunde als Warnsignal, das zu prospektiven Vergleichstudien zu den hier diskutierten Risiken bei Diabetikern mit und ohne Inkretinmimetika-Therapie führen sollte. Sie berichten über Tierversuche, in denen Sitagliptin zu vermehrter Zellteilung und zu Zellmetaplasien in Azini und Ausführungsgängen des exokrinen Pankreas, bei Ratten auch zu leichten Pankreatitiden geführt habe. Solche Metaplasien könnten auch Vorstufen eines Pankreaskarzinoms sein. In anderen Studien soll Liraglutid Schilddrüsentumore induziert haben. Engel et al. von der Firma Merck (USA) konnten die erwähnten Ergebnisse von Tierversuchen mit Sitagliptin nicht bestätigen (10). In ihrer Veröffentlichung wurden auch die UAW von Sitagliptin und anderen Antidiabetika bei über 10.000 Diabetikern in kontrollierten randomisierten Studien bis zu zwei Jahren Dauer mitgeteilt. Es ergab sich das gleiche Risiko für Pankreatitis bei Anwendung von Sitagliptin wie von Kontroll-Medikamenten oder Plazebo (0,08 vs. 0,10 Ereignisse pro 100 Patientenjahre).
Garg et al. von der Harvard- Universität in Boston (11) führten nach Bekanntwerden der ersten Meldungen über einen möglichen Zusammenhang zwischen Inkretinmimetika und Pankreatitis eine umfangreiche retrospektive Studie durch, in der medizinische Daten und Medikamentenverordnungs-Daten der „Medco National Integrated Database” von 786.656 Patienten ausgewertet wurden. Für Nicht-Diabetiker, Diabetiker unter Behandlung mit herkömmlichen OAD, Exenatid-Patienten und Sitagliptin-Patienten ergab sich folgende Pankreatitis-Häufigkeit pro 1.000 Patientenjahre: 1,9; 5,6; 5,7; 5,6. Das heißt, Typ-2-Diabetiker haben bereits per se ein 2-3fach höheres Pankreatitis-Risiko als Nicht-Diabetiker, eine Tatsache, die lange bekannt ist. Es wurden aber keine Unterschiede zwischen den Therapiegruppen gefunden. Diese Studie wurde offenbar nicht von Herstellerfirmen von Inkretinmimetika initiiert oder unterstützt.
In einer neueren Studie evaluierten Dore et al. (12) aus Providence und Boston, USA, Einträge der „Normative Health Information” (NHI) database eines kommerziellen Krankenversicherungs-Unternehmens. 25.719 Diabetiker ohne Pankreatitis-Vorgeschichte hatten zwischen Juni 2005 und Dezember 2007 eine Therapie mit Exenatid begonnen (Gruppe 1). 234.536 Diabetiker hatten die Behandlung mit anderen Antidiabetika begonnen (Gruppe 2). Patienten der Gruppe 1 waren angeblich adipöser und hatten mehr Ko-Medikation als die der Gruppe 2. In Gruppe 1 ereigneten sich 40, in Gruppe 2 254 bestätigte Fälle von akuter Pankreatitis bis zum Ende der Auswertung Ende März 2008. Das Relative Risiko (RR) für Patienten der Gruppe 1 bei „Current use” (aktueller Anwendung) von Exenatid wurde mit 0,5 (95%-Konfidenzintervall = CI: 0,2-0,9) berechnet, für „Re
cent use” (berechnetes Aufbrauchen der letzten verschriebenen Packung plus 31 Tage) mit 1,1 (CI: 0,4-3,2) und für „Past use” (mehr als 32 Tage nach Aufbrauchen der letzten Packung) mit 2,8 (CI: 1,6-4,7). Nach einer „Case-control analysis” erniedrigten sich die RR für current bzw. recent bzw. past use auf 0,2 (CI: 0-1,4) bzw. 0,1 (CI: 0-1,3) bzw. 1,1 (CI: 0,1-11) im Vergleich mit Gruppe 2. Die Autoren schließen aus den Befunden, dass der Gebrauch von Exenatid nicht mit erhöhter Inzidenz von akuter Pankreatitis assoziiert ist. Die einfache rechnerische Beziehung zwischen den o.g. Patientenzahlen und diagnostizierten Pankreatitiden würde jedoch im Beobachtungszeitraum für Gruppe 1 einen Pankreatitisfall auf 643, für Gruppe 2 einen Fall auf 923 Patienten ergeben. Diese Arbeit wurde über ein „i3 drug safety”-Programm der Firma Amylin Pharmaceuticals, Inc. gefördert, und zwei Autoren sind Mitarbeiter dieser Firma.
Elashoff et al. (3) widmen einen erheblichen Teil in der Diskussion ihrer Arbeit der Besprechung und Relativierung der methodischen Schwächen. Sie diskutieren auch ausführlich die Ergebnisse von Tier- und In-vitro-Versuchen. Die Prüfung eines Zusammenhangs zwischen der Anwendung von Inkretinmimetika und Schilddrüsenkrebs geht auf Versuche der Firma Novo Nordisk an Mäusen zurück, die nach Anwendung hoher Dosen Liraglutid bei dieser Spezies vermehrt C-Zell-Karzinome der Schilddrüse fand (13). In der Meldeliste der AERS wurde aber nicht zwischen C-Zell-Karzinomen und den viel häufigeren von Thyreozyten ausgehenden Karzinomen unterschieden.
Insgesamt beurteilen wir die Methodik von Elashoff et al. (3), ungeprüfte UAW-Meldungen von Ärzten und Patienten als Basis für die Berechnung von Relativen Risiken zu benutzen, als problematisch, auch wenn „Kontrollen” von unklarem Wert als Vergleich herangezogen werden. Risikohinweise hinsichtlich Pankreatitis bei Anwendung von Inkretinmimetika sind inzwischen in allen Werbungen, Fachinformationen und Packungsbeilagen für diese Antidiabetika Pflicht. Die hier besprochene Veröffentlichung fügt dem nichts Substanzielles hinzu. Die drei zitierten Auswertungen prospektiver und retrospektiver Studien sprechen gegen ein erhebliches Pankreatitisrisiko bei Anwendung von Exenatid und Sitagliptin, auch wenn man bei Urheberschaft bzw. finanzieller Unterstützung zweier dieser Untersuchungen durch pharmazeutische Hersteller skeptisch bleiben muss.
Wir wissen nicht, ob Inkretinmimetika bei Langzeitanwendung Morbidität und Letalität von Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 verringern. Das trifft – vermutlich mit Ausnahme von Metformin – auch auf andere Antidiabetika zu. Fast alle Inkretinmimetika sind mit Anwendungsbeschränkungen zugelassen worden, die unbedingt beachtet werden müssen. Wir empfehlen die primäre Behandlung mit länger bekannten Antidiabetika, wenn Umstellung der Ernährung und mehr Bewegung nicht ausreichen, und ein immer waches Auge auf mögliche UAW.
Die Druckfassung der Arbeit von Elashoff et al. (3) wird von einem ausführlichen und kompetenten Editorial mit dem Titel „GLP-1-Based Therapies: The Dilemma of Uncertainty” begleitet (14). Die Autoren sind J. Spranger, U. Gundert-Remy und T. Stammschulte aus Berlin. Zwei der Autoren sind Mitglieder der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft. Pankreatitis, Pankreaskarzinom, Schilddrüsenkarzinom und mögliche Karzinogenese allgemein unter dem Einfluss von Inkretinmimetika werden ausführlich besprochen und daran erinnert, dass es lange gedauert hat, bis die unerwünschten kardiovaskulären Wirkungen schließlich zur Marktrücknahme von Rosiglitazon geführt haben. Der letzte Satz dieses Editorials lautet: ”Two thoughts remain: Primum non nocere and vigilance equals avoidance”.
Literatur
- Hawkes, N.: BMJ 2011, 342,d2335. Link zur Quelle
- Elashoff, M., et al.:Gastroenterology 2011, 141, 150. Link zur Quelle
- AMB 2007, 41,50. Link zur Quelle
- AMB 2007, 41,88. Link zur Quelle
- AMB 2009, 43,01. Link zur Quelle
- AMB 2009, 43,06. Link zur Quelle
- AMB 2010, 44,65. Link zur Quelle
- Elashoff, M., et al.:Gastroenterology, online 1. Feb. 2011.
- AMB 2010, 44, 78a. Link zur Quelle
- Engel, S.S., et al.: Int.J. Clin. Pract. 2010, 64, 984. Link zur Quelle
- Garg, R., et al.:Diabetes Care 2010, 33, 2349. Link zur Quelle
- Dore, D.D., et al.:Diabetes Obes. Metab. 2011, 13, 559. Link zur Quelle
- Victoza® (Liraglutideinjection): Human relevance of rodent thyroid C-cell tumors. 2009; Link zur Quelle (Zugriff 21.7.2011).
- Spranger, J., et al.:Gastroenterology 2011, 141, 20. Link zur Quelle